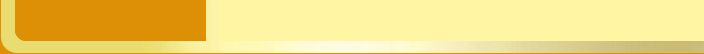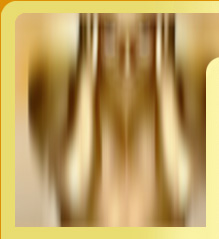



 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
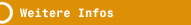 |
 |
 |
 |

Ziel der Verhaltenstherapie ist es, dass man sich seinen Ängsten stellt. Die negativen Gedanken müssen zugelassen werden und sie müssen langweilig werden. Als ich dies zum ersten Mal gehört hatte, wollte ich auch ganz schnel das Weite suchen. ABER als es dann an die Übungen ging, wurde mir das Prinzip immer klarer und
ES FUNKTIONIERT !
Kognitionsorientierte Verfahren sollen dazu dienen, eine langfristige
kognitive Umstrukturierung zu erreichen: negative Kognitionen sollen
durch rationalere ersetzt werden, was zu aktiverem, kompetenterem
Verhalten führen soll. Zu den kognitionsorientierten Verfahren gehören:
Sammeln und Aufzeichnen automatischer Gedanken
Zweispaltentechnik: Argumentieren gegen automatische Gedanken
Erkennen von Mustern kognitiver Verzerrungen
Realitätstesten: Testen der Kognitionen
Umattribution: Trennung der Verantwortlichkeiten
Entkatastrophisieren
Aufbau von Erwartungen
Oder auch mit anderen Worten: Man soll seine eigenen Gedankenmuster, die automatischen Gedanken, erkennen und sie hinterfragen. Man muss realistische Gedanken entwickeln und diese gegen die automatischen beängstigen Gedanken stellen.
In
Therapie
Bevor
es losging, hatte ich eine richtige Odyssee hinter mir. Allerdings
nicht weil die Ärzte oder irgendwelche Behörden mit das
Leben schwer machten. Nein das machte ich mir schon ganz alleine. Es
ist schon ein verzwickte Situation, wenn man einen Therapeuten
anrufen muss, aber auf Grund seiner Zwänge nicht telefonieren
kann. So siegte mein Zwang bei jeder Schlacht. Die Termine, die
zustande kamen ließ ich platzen, weil – ja weil es alles so
fremd war und ich mich noch immer schämte mit anderen darüber
zureden. Nun bekam ich ja auch schon Medikamente. Fluoxitin – ein
wahres „Wundermittel“. Die 20mg reduzierten die Zwänge schon
gut, aber eben noch nicht gut genug. Auch hatte ich mir irgendwie an
die Zwänge gewöhnt, denn es war bis jetzt schon 25 Jahre
vergangen. Hört such vielleicht komisch an, aber dieses Leben
war für mich „normal“ geworden. Ich kannte meine Welt eben
nicht besser und wenn ich nur geahnt hätte wie sich alles ändern
könnte, wäre ich mehr hinterher gewesen.
Die
Zwänge waren lästig, aber ich hatte mich arrangiert. Die
Depression war allerdings schon zu einer lebensgefährlichen
Sache geworden. Aber erstens kommt es anders und zweitens als man
denkt !
Die
Hilfe kam letztendlich aus einer ganz anderen Richtung. Unsere
Tochter (12) fing an, meiner Frau und mir, große Sorgen zu
machen. Kurz gesagt, sie zeigte alle Symptome einer Depression. Als
sie sich uns öffnete und uns erzählte wie es ihr wirklich
geht, gingen wir sofort zu unserem Hausarzt. Der reagierte ebenfalls
sofort und ehe wir uns versahen, war unsere Kleine in der Tagesklinik
der Kinder- und Jugendpsychologie des UKE Hamburg. Bei Kindern wird
nicht lange gefackelt. Es gab einige Vorgespräche. Das erste
führten wir als Eltern alleine mit einer Psychologin. Im
Verlaufe diese Gesprächs kamen auch meine Leiden an die
Oberfläche und es wurde mir nicht nur geraten, sondern zum Wohle
meiner Tochter verlangt, dass ich mich ebenfalls in eine Therapie
begebe. Doch die Ärzte meiner Tochter mussten mir erst drohen,
sie von der Liste zu streichen, wenn es nicht auch bald bei mir
losgehen würde. So kam ich in die Puschen und traf meinen
dritten Psychiater. Aber dieser war ganz anders als die Anderen, denn
ergab mir nicht nur endlose Listen mit Therapeuten, sondern er
drückte mir auch eine Einweisung für die Tagesklinik im UKE
in die Hand. Witzigerweise genau ein Gebäude neben meiner
Tochter. So meldete ich mich im August 2009 an und nach zwei
Vorgesprächen kam der Anruf, der alles verändern sollte
.
26.
Oktober 2009 9:00 Uhr
Mein
erster Tag und ich kam viel zu spät. Was für ein Einstieg.
Ein Umstand, den ich mir nicht verzeihen konnte. Nun war ich da und
wurde sehr lieb aufgenommen. Ich lernte allerlei Menschen kennen.
Meine Therapeutin, meinen Co-Therapeuten, meine Ärztin und
natürlich den Oberarzt. An diesem Tag habe ich immer wieder das
Gleiche erzählt. Die erste Zeit in der Therapie ist die
Kennenlernphase. Man kommt als unbeschriebenes Blatt und die
Therapeuten müssen hinter die oft verzwickte Logik des Zwangs
oder der Zwänge kommen. Bei mir dauerte dies vier Wochen zumal
auch die Depression zuerst im Vordergrund stand. So hatte ich in den
ersten vier Wochen so weit nichts zutun, als zur Ruhe zukommen. Ich
fühlte mich wie jemand, der von einem fahrenden Karussell
abgesprungen ist. Eben noch im täglichen Stress und jetzt war es
ruhig und alles stand still. Viel neue Gesichter, eine fremde
Umgebung und ein ganz neuer Tagesablauf. Es waren viele neue
Eindrücke, die es erst einmal zu verarbeiten galt.
Endlich
normale Menschen
Doch
eines hatte bald ein Ende und da kam ich schnell dahinter. Man
brauchte sich nicht verstecken und nicht zu verstellen. Ich erkannte
Verhaltensweisen bei anderen wieder, die von mir gut kannte und wenn
ich den einen oder anderen Patienten dabei beobachteten konnte, wie
er eine Bewegung wiederholt oder ein paar Mal in den Raum hinein und
wieder hinaus geht, wusste ich ganz genau, was in diesem Menschen
Vorsicht geht und schnell empfand ich keine Scham mehr, wenn es mir
dann auch ab und zu „passierte“. Hier waren Zwänge, Ängste
und Depressionen kein Tabu mehr. Nirgends geht man so offen und
normal damit um. Und so manch einer von den „Normalos“ würden
über den Humor, der hier herrscht sehr erschrocken sein. Denn
Redewendungen wie „sei doch völlig zwanglos“ oder „keine
Angst“, haben hier einen völlig anderen Stellenwert. Oder wenn
man denn einmal auf das Örtchen muss, heißt es eben „Ich
bin mal für kleine Psychopathen.“ Freud und Leid leben hier
dicht an dicht. Eben noch hast du noch mit den Anderen ausgelassen
gelacht und schon kam die Nächste völlig verweint und
aufgelöst auch einem Gespräch. Es kam auch vor, dass die
Stationstür aus Sicherheitsgründen geschlossen wurde. Das
waren schon bedrückende Momente, die jeden vor Augen führte
wo man sich befand und es eben hier anders zugeht, wie auf anderen
Stationen. Man war immer für den Anderen da und tröstete
sich gegenseitig oder tauschte Erfahrungen aus. Es gab aber auch
Tage, die so ausgelassen waren, dass wir vergessen hatten wo wir
waren.
Aber
eine Eigenschaft hat mich am meisten beeindruck. Das ist die
Fähigkeit aller Patienten, das Leben von einem anderen
Standpunkt zu betrachten. Zwischen die Lücken im Zaun zu schauen
und den Hintergrund zu erkennen. Alle hatten eine enorme Sensibilität
Dinge zu sehen und zu erfassen, die für viele einfach zu
alltäglich sind. Wir alle hatten bitter erfahren müssen,
was die Gesellschaft aus einem machen konnte und wie mit einem
umgegangen wird, der nicht mehr Schritt halten kann. Erbarmungslos
wird man übergangen, denn bedingt durch Leistungsdruck,
Profitdenken und immer weniger Aufklärung in einer immer
mannigfaltigen Medienwelt, stehst Du irgendwie abseits. Ein
Querschnitt durch die Berufe der Patienten zeigt, dass diese
Krankheit nichts, aber auch überhaupt nichts, mit dem sozialen
Umfeld, dem Bildungsgrad und dem Alter zu tun hat. Wir hatten
Kaufleute, Sozialpädagogen, Techniker, Studenten , Lehrer,
Zugführer, einen Arzt, Informatiker, Leute aus der Chefetage und
den „einfachen“ Angestellten. Der jüngste Patient war 18 und
der Älteste 73. Wir waren der Beweis dafür, dass es jeden
erwischen kann.
Für
mich war es schon jedes Mal eine kleine Therapie mit den Patienten zu
reden. Allein zu erkennen, dass man wirklich nicht alleine ist, denn
genau das hatte ich all die Jahre gedacht.